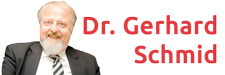Mit großer Trauer gibt die SPÖ Bundesbildungsorganisation den Tod von Peter Vitouch bekannt, einem angesehenen Wiener Kommunikationswissenschaftler und langjährigen Dozenten an der Universität Wien. Peter Vitouch verstarb am 1. Juli im Alter von 76 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.
SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Prof. Dr. Gerhard Schmid: “Peter Vitouch war ein großer Humanist und ein Vordenker in Richtung Toleranz! Das Thema Demokratie war ihm auch in seiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung von größter Bedeutung. Als Medienpsychologe hat er aus seinem Blickwinkel die Rolle der Medien in einer funktionierenden Demokratie analysiert. Peter hinterlässt eine nicht zu schließende Lücke. Mögen seine Werte von seinen Schülerinnen und Schülern in die Zukunft getragen werden! Unsere große Anteilnahme gilt seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!”
SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer Wolfgang Markytan äußerte sich ebenfalls bestürzt über den Verlust und würdigte Vitouch als eine herausragende Persönlichkeit, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise maßgeblich zur Entwicklung des Bildungswesens beigetragen habe. “Peter Vitouch hinterlässt eine bedeutende Lücke in der Bildungsforschung und im akademischen Bereich. Sein Beitrag zur psychologischen Medienforschung und sein Einsatz für eine qualitativ hochwertige Bildung werden uns immer in Erinnerung bleiben. Ich kenne selbst viele Absolvent*innen seiner Kurse und weiß, wir prägend er für seine Schüler*innen war”
Peter Vitouch war nicht nur ein renommierter Wissenschaftler, sondern auch ein gefragter Autor, der zahlreiche Bücher veröffentlichte und regelmäßig Kolumnen in namhaften Zeitungen schrieb. Sein Wirken beschränkte sich jedoch nicht allein auf den akademischen Bereich. Er engagierte sich auch als Berater für Medienprojekte und war Mitglied des ORF-Publikumsrats.
Die SPÖ Bundesbildungsorganisation trauert um einen außergewöhnlichen Menschen, der sein Wissen und seine Leidenschaft für Bildung in vielfältiger Weise eingebracht hat. Seine Verdienste und sein Erbe werden in der Bildungsforschung und -praxis weiterleben.
Die feierliche Urnenbeisetzung von Peter Vitouch findet am 16. September auf dem Friedhof Neustift am Walde in Wien-Währing statt. Die SPÖ Bundesbildungsorganisation drückt der Familie, insbesondere seiner Ehefrau Elisabeth Vitouch, sowie den beiden Söhnen Oliver Vitouch und Anatol Vitouch ihr tief empfundenes Beileid aus.
Biographie
Nach dem Abschluss seines Kontrabass-Studiums an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien studierte Peter Vitouch Psychologie an der Universität Wien und war ab 1970 Studienassistent am Institut für Psychologie. 1973 promovierte er zum Dr. phil. und wurde im selben Jahr Universitätsassistent am Institut für Psychologie der Universität Wien. Er absolvierte eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Seit 1975 war er beratender Konsulent der ORF-Kinderfernsehserie “Am, dam, des…”. Neben dem ORF beriet er zwischen 1975 und 1982 auch den BR und den NDR. Er arbeitete an ca. 900 Sendungen mit.
Damals verfasste er auch erste Publikationen im Bereich Medienpsychologie: “Emotion und Erregung – Kinder als Fernsehzuschauer” und “Medienvermittelte Pausen und Lerneffekte”.
Von 1978 bis 1986 war Peter Vitouch Kuriensprecher bzw. stellvertretender Kuriensprecher der Mittelbaukurie an der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät (GRUWI). 1986 habilitierte er sich für das Gesamtfach Psychologie und wurde 1988 als Fachfremder als Professor an das Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien berufen. Vitouch war einer der Pioniere der psychologischen Medienforschung in Österreich. Lehraufträge führten ihn auch an die Universitäten Graz und Klagenfurt.
1991 gründete Vitouch das Ludwig Boltzmann-Institut für empirische Medienforschung, das bis 2005 bestand und dessen Leiter er während der gesamten Dauer war.
Peter Vitouch war unter anderem Kuriensprecher der Professorenkurie der GRUWI-Fakultät, stellvertretender Vorsitzender des Senats und Vize-Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien sowie stellvertretender Institutsvorstand des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. 2010 wurde er vom Bundeskanzleramt in den ORF-Publikumsrat entsandt.
Peter Vitouch veröffentlichte zahlreiche Monographien und Aufsätze zur Medienpsychologie. Er war Mitbegründer und seit 1990 Mitherausgeber der wissenschaftlichen Zeitschrift “Medienpsychologie”.
Von 1995 bis 2003 schrieb er eine wöchentliche Kolumne in der Tageszeitung “Kurier“ und von 2004 bis 2006 eine wöchentliche Kolumne in der Tageszeitung “Die Presse“.
Nach seiner Emeritierung 2012 trat Peter Vitouch auch als bildender Künstler an die Öffentlichkeit. 2014 zeigte er seine Bilder in einer Ausstellung am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Universität Wien.
Werke (Auswahl)
- Cognitive Maps und Medien. Formen mentaler Repräsentation bei der Medienwahrnehmung Frankfurt am Main: Peter Lang 1996 (Hg. gemeinsam mit Hans-Jörg Tinchon)
- Fernsehen und Angstbewältigung. Zur Typologie des Zuschauerverhaltens. Opladen: Westdeutscher Verlag 1993
- In Medias Res. Gedanken hinter einer Kolumne. Wien: Holzhausen 1998
- Psychologie des Internets. Wien: WUV-Universitätsverlag 2001/2004 (2 Bände, hg. gemeinsam mit Andrea Payrhuber)
Literatur
Links
Biographische Daten und Bild